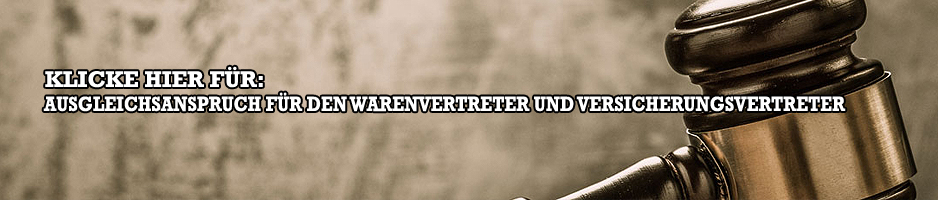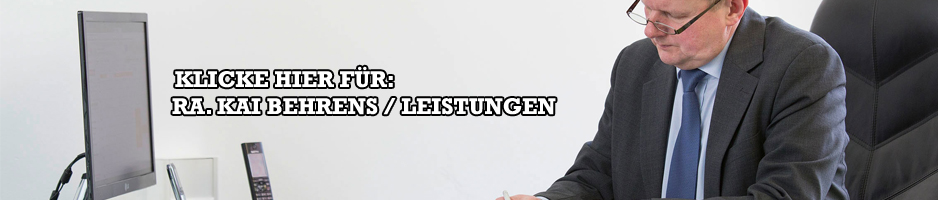03
Der Verein GfK hat wieder einmal verschiedene Berufe auf ihre Beliebtheit getestet.
Die Deutschen vertrauen Feuerwehrleuten und Sanitätern am meisten, Politikern und Versicherungsvertretern am wenigsten.
Trotz Abgas-Skandal verzeichnen die Ingenieure und Techniker den größten Vertrauenszuwachs. Mit sechs dazugewonnenen Prozentpunkten vertrauen ihnen aktuell 86 Prozent. Damit konnten sie sich von Rang 10 auf Rang 8 verbessern.
Banker scheinen sich langsam von ihrem Vertrauenstief zu erholen: Der Anteil derer, die zu Bankangestellten Vertrauen haben wollen, stieg von 39 auf 43 Prozent.
Die hinteren Plätze belegen Werbefachleute (27 Prozent) und Versicherungsvertreter mit 22 Prozent (2014 19 Proz.). Politiker verharren – wie vor zwei Jahren – auf dem letzten Platz. Nahezu unverändert vertrauen ihnen gerade einmal 14 Prozent der Bürger.
Dass Versicherungsvertreter abermals, wie die Jahre zuvor, so unbeliebt sind, ist zu kritisieren. Um das Vertrauen der Bürger zu dieser Branche zu fördern, hatte man viele gesetzliche Veränderungen angeregt und teilweise durchgesetzt. Natürlich kann man verschwundenes Vertrauen „gesetzlich“ nicht einfach wiederherstellen. Aber das Ergebnis zeigt, dass die wenigen gesetzlichen Maßnahmen nicht ausreichend sind, um das zu retten, was Versicherer und Vertriebe seit vielen Jahren angerichtet haben.
Hier die Rangliste:
Die Top-Ten in der Übersicht:
Feuerwehrleute (96 Prozent)
Sanitäter (96 Prozent)
Krankenschwestern/- pfleger (95 Prozent)
Apotheker (90 Prozent)
Ärzte (89 Prozent)
Lok-, Bus-, U-Bahn, Straßenbahnführer (89 Prozent)
Piloten (87 Prozent)
Ingenieure, Techniker (86 Prozent)
Lehrer (82 Prozent)
Polizisten (82 Prozent)
Die letzten zehn Plätze in der Übersicht:
Unternehmer (54 Prozent)
Händler, Verkäufer (52 Prozent)
Schauspieler (48 Prozent)
TV-Moderatoren (48 Prozent)
Banker, Bankangestellte (43 Prozent)
Profisportler, -fußballer (42 Prozent)
Journalisten (36 Prozent)
Werbefachleute (27 Prozent)
Versicherungsvertreter (22 Prozent)
Politiker (14 Prozent)
Quelle: Auszug aus dem Trust in Professions Report 2016