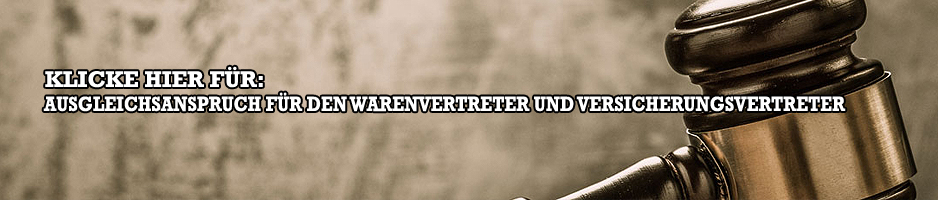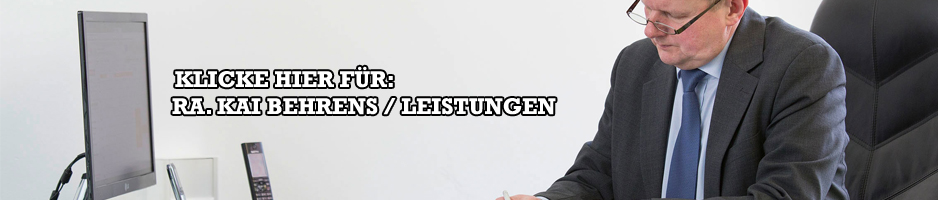27
Bekanntlich vermitteln Handelsvertreter Geschäfte für die jeweiligen Unternehmen.
Dabei wird der Handelsvertreter regelmäßig nicht Vertragspartner der Kunden. Der Kunde schließt mit dem jeweiligen Unternehmen einen Vertrag. Erfüllt der Kunde den Vertrag nicht, weil er z.B. nicht bezahlen kann, trifft dies zunächst das Unternehmen. Allerdings erhält der Handelsvertreter für ein nicht erfolgreiches Geschäft auch keine Provision.
Der Unternehmer hat sich jedoch darum zu kümmern, dass der Kunde das Geschäft auch tatsächlich erfüllt. Zumindest muss er den Kunden mahnen, teilweise muss er sogar noch mehr tun.
Es ist möglich, das Risiko des Zahlungsausfalles des Kunden auf den Handelsvertreter komplett zu übertragen. Dies nennt man Delkredere.
Wenn zwischen dem Unternehmer und dem Handelsvertreter eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird, verpflichtet sich der Handelsvertreter, für die Verbindlichkeit aus dem Geschäft selbst einzustehen. Wenn der von ihm vermittelte Kunde nicht an den Unternehmer zahlt, kann der Unternehmer das Geld stattdessen vom Handelsvertreter verlangen.
Diese Delkrederevereinbarung muss schriftlich und für ein oder mehrere konkrete Geschäfte vereinbart werden. Teilweise wird deshalb eine solche Delkredereabsprache mit einer Bürgschaft verglichen.
Der Handelsvertreter wird sich jedoch auf so ene Delkrederevereinbarung nur einlassen, wenn er auch davon Vorteile hat. Gesetzlich wäre er nicht verpflichtet, das Ausfallrisiko eines von ihm vermittelten Geschäftes zu tragen. Wenn er sich dennoch auf eine Delkrederevereinbarung einlässt, steht ihm auch eine so genannte Delkredereprovision gemäß § 86 b HGB zu.
Diese Delkredereprovision kann er danach einfordern. Ausgenommen sind davon internationale Geschäfte, bei denen der Unternehmer oder der Kunde im Ausland seinen Sitz hat, oder wenn der Handelsvertreter eine unbeschränkte Vollmacht zum Abschluss oder zur Ausführung der Geschäfte hatte.