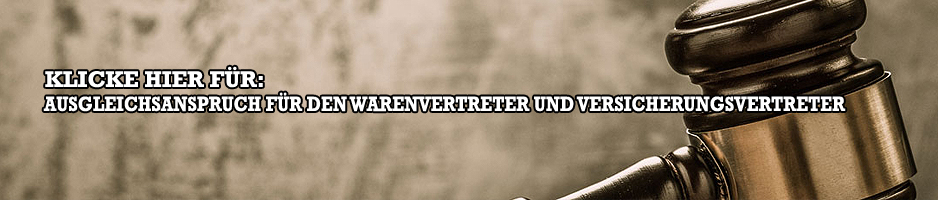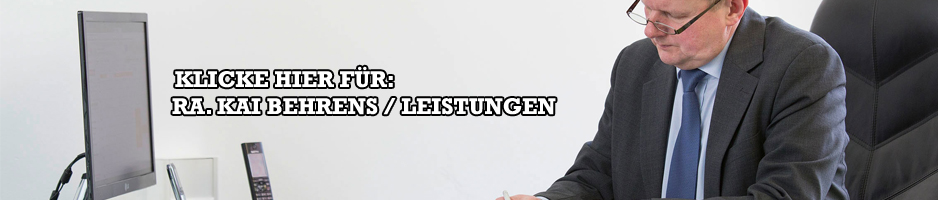28
Einem Handelsvertreter, der sich vertraglich einem Wettbewerbsverbot unterwirft, steht eine Karenzentschädigung zu ( §90 a HGB).
Das Oberlandesgericht Nürnberg hatte am 26. Januar 2011 entschieden, dass einem Handelsvertreter dieser Anspruch nicht zusteht, wenn er sich im Aufhebungsvertrag für die Zeit nach Vertragsbedingung einer Wettbewerbsbeschränkung unterwirft.
Der Karenzanspruch sei nach der Auffassung des Gerichts kein Schadensersatz, sondern Entgelt für die Abrede der Wettbewerbsenthaltung. Der Anspruch ergebe sich aus § 90 a HGB. Der Unternehmer schulde die Entschädigung sogar dann, wenn er angenommen habe, dass ihn die Abrede nichts koste. Wenngleich das Gesetz von einer „Entschädigung“ spreche, handele es sich um ein den Umständen nach angemessenes Entgelt für die vereinbarte Wettbewerbshaltung. Dieses solle den Lebensbedarf des Vertreters für die Dauer der ihm auferlegten Wettbewerbsbeschränkung sichern.
Die Karenzentschädigung sei eine vertragliche Gegenleistung für das im Vertrag versprochene Unterlassen des Wettbewerbs.
Schließt der Handelsvertreter die nachvertragliche Wettbewerbsabrede aber in einem sofort wirksam werdenden Aufhebungsvertrag, steht nach Auffassung des Nürnberger Gerichts dem Vertreter eine Karenzentschädigung nicht zu. Aus § 90 a HGB ergibt sich nämlich, dass die Vorschrift nur auf solche Vereinbarungen Anwendung finde, die vor Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses getroffen werden. Wettbewerbsverbote, die in einer Vereinbarung über die Beendigung des Handelsvertretervertrag enthalten sind, und die den Vertretervertrag sofort (oder rückwirkend) beendeten, seien von der Schutzvorschrift des § 90 a HGB nicht erfasst. Nur dann, wenn ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot in einer Vereinbarung geregelt wird, die den Vertretervertrag zu einem späteren Zeitpunkt beendet, kann der eine Karenzentschädigung verlangt werden.
Da vom Bundesverfassungsgericht lediglich eine uneingeschränkte gesetzliche Gestattung eines entschädigungslosen nachvertraglichen Wettbewerbsverbots als verfassungswidrig angesehen worden, wäre diese Betrachtung auch nicht verfassungswidrig, so das Gericht.