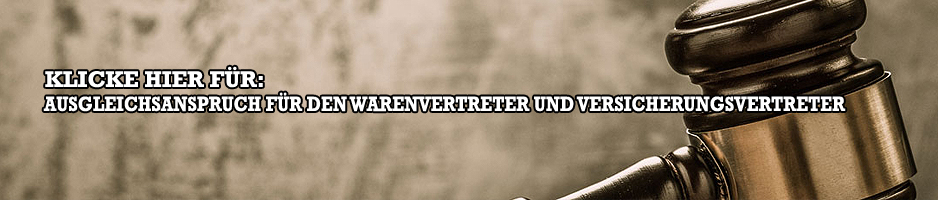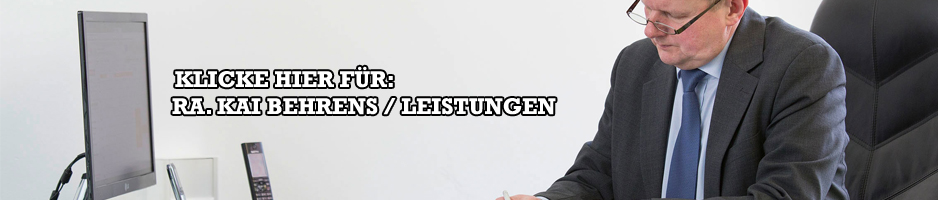Am 17.4.2019 entschied das OLG München unter dem Az 7 U 2711/18, im Rahmen eines handelsvertreterfreundlichen Urteils, was eigentlich längst klar sein sollte.
Ein Buchauszug darf mehrmals eingeklagt werden darf, er darf nicht z.B. wegen Untätigkeit des Handelsvertreters zurückgehalten werden und die Frage, ob Provisionsansprüche bestehen, darf nicht vorweggenommen werden.
Hier nun die Leitsätze des OLG und die Begründung in Kurzform:
1. In der Erteilung eines Buchauszugs ist keine Vorwegnahme der Entscheidung darüber enthalten, ob das in ihm aufgenommene Geschäft auch provisionspflichtig ist oder nicht, so dass nur zweifelsfrei nicht provisionspflichtige Geschäfte bei der Erteilung des Buchauszugs unberücksichtigt bleiben können (stRspr BGH BeckRS 9998, 76461).
Gemäß § 87c Abs. 2 HGB kann der Handelsvertreter „einen Buchauszug über
alle Geschäfte verlangen, für die ihm nach § 87 Provision gebührt“.
Entgegen der Ansicht der Beklagten ist diese Norm nach der
Rechtsprechung des BGH nicht dahingehend auszulegen, dass es ohne
feststehende Pflicht zur Provisionszahlung keine Verpflichtung zum
Buchauszug gäbe (vgl. Berufungsbegründungsschriftsatz des
Beklagtenvertreters vom 11.09.2018 (dort S. 6, Bl. 400 d.A.). Vielmehr
darf die Erteilung des Buchauszugs „keine Vorwegnahme der Entscheidung
darüber enthalten, ob das in ihm aufgenommene Geschäft auch
provisionspflichtig ist oder nicht (…). Nur die zweifelsfrei nicht
provisionspflichtigen Geschäfte können bei der Erteilung des Buchauszugs
unberücksichtigt bleiben“ (BGH, Urteil vom 23.02.1989, Az. I ZR 203/87,
Rdnr. 14, OLG Nürnberg, Beschluss vom 28.01.2011, Az. 12 U 744/10,
Rdnr. 28, Senatsurteil vom 11.04.2018, Az. 7 U 1972/17, Rdnr. 37, vgl.
auch OLG Hamm, Urteil vom 17.12.2009, Az. 18 U 126/07, Rdnr. 116 aE).
2. Der Prinzipal kann dem Buchauszugsanspruch des Handelsvertreters nach § 87c Abs. 2 HGB mit einem Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenansprüchen nicht entgegentreten.
Da der Prinzipal dem Buchauszugsanspruch des Handelsvertreters nach §
87c Abs. 2 HGB mit einem Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenansprüchen
nicht entgegentreten kann (vgl. Hopt in Baumbach/Hopt, HGB, 38. Auflage,
München 2018, Rdnr. 29 zu § 87c HGB; Löwisch in
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 3. Auflage, München 2014, Rdnr. 36
zu § 87c HGB), kommt es insoweit nicht darauf an, dass die Beklagte
schon nicht vorgetragen hat, welche Gegenansprüche sie überhaupt geltend
macht. Die bloße – von der Beklagten behauptete – Untätigkeit des
Handelsvertreters begründet jedenfalls per se noch keine Gegenansprüche.
3. Für eine die außerordentliche Kündigung des Handelsvertretervertrages vorbereitende Abmahnung genügt es nicht, wenn der Prinzipal gegenüber dem Handelsvertreter immer wieder fernmündlich zum Ausdruck bringt, mit der Bearbeitung des Vertragsgebiets nicht zufrieden zu sein, und diesen ermahnt und auffordert, mehr zu tun als nur irgendwelche öffentliche Ausschreibungen von deutschen Unternehmen weiterzuleiten.
Jedoch setzt eine solche außerordentliche Kündigung grundsätzlich sowohl im Leistungs- als auch im Vertrauensbereich eine vorherige Abmahnung des Handelsvertreters durch den Prinzipal voraus (vgl. hierzu die Nachweise aus der Rechtsprechung bei Hopt in Baumbach/Hopt, HGB, 38. Auflage, München 2018, Rdnr. 10 zu § 89a HGB). Wie das Landgericht (LGU S. 8) zutreffend ausgeführt hat, ist eine solche durch die Beklagte schon nicht vorgetragen worden. Denn nach Rechtsprechung des BGH muss eine Abmahnung den Schuldner darauf hinweisen, dass er vertragliche Pflichten verletzt hat und ihm für den Fall eines weiteren Vertragsverstoßes Konsequenzen drohen. Dabei ist zwar keine ausdrückliche Kündigungsandrohung erforderlich, jedoch muss aus der Erklärung des Gläubigers für den Schuldner deutlich werden, dass die weitere vertragliche Zusammenarbeit auf dem Spiel steht (BGH, Urteil vom 12.10.2011, Az. VIII ZR 3/11, Rdnr. 17 m.w.N. aus der BGH-Rechtsprechung). Im Schriftsatz ….. wird nämlich nur ausgeführt, die Beklagte habe „die Klägerin immer wieder ermahnt“.
4. Aus dem Umstand, dass der Handelsvertreter für einen früheren Zeitraum schon eine Verurteilung des Prinzipals zur Erteilung eines Buchauszugs erwirkt hat, lässt sich nicht herleiten, dass der Prinzipal nunmehr davon ausgehen darf, dass er keinen weiteren Buchauszug für einen anderen Zeitraum mehr erteilen muss.
Aus der Tatsache, dass die Klägerin unstreitig für den vor dem streitgegenständlichen Zeitraum liegenden Zeitraum schon eine Verurteilung der Beklagten zur Erteilung eines Buchauszugs erwirkt hat, lässt sich nicht herleiten, dass die Beklagte nunmehr davon ausgehen durfte, dass sie keinen weiteren Buchauszug für einen anderen Zeitraum mehr erteilen müsse. Damit somit weder Verjährung noch Verwirkung vorliegen, war der Buchauszug dem Grunde nach auch für den Zeitraum vom zu erteilen.
Zum Thema Verjährung meinte das OLG, dass der Lauf der Verjährung gem der neuen Rechtsprechung des BGH (BGH, Urteil vom 03.08.2017, Az. VII ZR 32/17) noch gar nicht begonnen hat. Denn: Provisionsabrechnungen durch die Beklagte erfolgten jedoch unstreitig nicht. Nach der Rechtsprechung des BGH hat damit im streitgegenständlichen Fall die Verjährungsfrist für die Erteilung des Buchauszugs noch gar nicht begonnen.