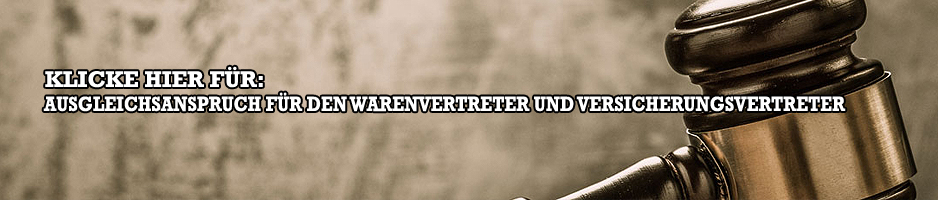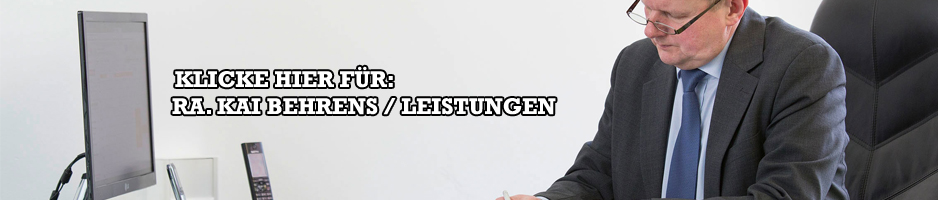Die Generali Lebensversicherung AG wurde vom Bundesarbeitsgericht verurteilt, an einen ehemaligen angestellten Mitarbeiter rückständige Pensionsergänzungen für die Monate Juli 2015 bis März 2017 nebst Zinsen zu zahlen.
Die Generali wurde schon in voriger Instanz beim Landesarbeitsgericht Hamburg zur Zahlung verurteilt.
Ein Mitarbeiter der Generali klagte und machte Ansprüche aus dem betrieblichen Versorgungswerk (BVW) der Generali geltend. Mittlerweile war er nicht meht tätig und Betriebsrentner. Das Generali- Versorgungswerk gewährt ihren Betriebsrentnern betriebliche Versorgungsbezüge im Rahmen eines Gesamtversorgungssystems.
Die Parteien streiten um eine Betriebsrentenanpassung im Jahr 2015. Das Arbeitsgericht Hamburg hat der Klage teilweise stattgegeben, das Landesarbeitsgericht Hamburg hat die Berufung der Generali zurückgewiesen. Die Generali hat im ihr durch § 6 Ziff. 3 der Ausführungsbestimmungen des Betrieblichen Versorgungswerkes rechtmäßig entschieden, die Renten im Jahr 2015 um 0,5 % anzuheben.
Bundesweit werden Massenverfahrens mit mehr als 800 Klagen geführt.
Umstritten ist die Anwendung einer Ausnahmeregelung bei der Rentenanpassung und auch die Berechnungsmethode bei der parallel durchgeführten gesetzlichen Anpassung.
Das BAG sprach grundsätzlich dem Betriebsrentener eine Rentenerhöhung zu, die dieser gemäß der gesetzlichen Anpassung einforderte. Das BAG machte sich dazu eigene vertiefte Gedanken.
- Das in diesem System zugesagte Gesamtversorgungsniveau wird grundsätzlich entsprechend der Renten der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst (Ausnahme ist § 6 Ziff. 3 AusfBest BVW).
- § 6 Ziff. 3 AusfBest BVW ist wirksam.
- Es muss beachtet werden, dass der vertraglichen Anpassungsregelung in der Betriebsvereinbarung eine freiwillige unternehmerische Entscheidung im Rahmen des Dotierungsrahmens vorausgegangen ist. Die von Gesetz und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die gesetzliche Anpassung des § 16 BetrAVG sind deshalb nicht auf die vertragliche Anpassungsregelung anwendbar.
- Im Rahmen von vertraglichen, freiwilligen Anpassungsregelungen müssen deshalb andere, weniger strenge Anforderungen an die Prüfungsmaßstäbe und Darlegungslast gestellt werden. Diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen gesetzlicher und vertraglicher Anpassungsregelung wurde von der angegriffenen Entscheidung verkannt.
- Die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes gewahrt bleiben.
Man muss unterscheiden:
Es gibt Betriebsrentner, die Ansprüche aus einem betrieblichen Versorgungswerk bei der Beklagten haben. Es gibt den Betriebsrentnern eine Gesamtversorgung in einer nach den Bestimmungen des BVW zu errechnenden Höhe. Diese Gesamtversorgung setzt sich aus drei unterschiedlichen Bestandteilen zusammen bzw. sind diese auf den dem einzelnen Betriebsrentner zustehenden Betrag anzurechnen. Auf die Gesamtversorgung sind zuerst der gesetzliche Rentenanspruch sowie der ihr zustehende Anspruch aus der Versorgungskasse (VK-Rente) anzurechnen. Der verbleibende Betrag ist die sogenannte Pensionsergänzung (Vofue-Rente). Dieses Versorgungswerk kam für alle ehemals bei der Generali beschäftigen Arbeitnehmer zur Anwendung, welche vor dem Jahr 1985 in ein Arbeitsverhältnis bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten eingetreten sind.
Über einen solchen Fall hatte hier das BAG zu urteilen.
Ein anderer Teil der Rentner haben im Rahmen von mit der Generali geschlossenen Aufhebungs- bzw. Frühpensionierungsverträgen von den grundsätzlichen Regelungen abweichende Vereinbarungen getroffen. In diesen Fällen wurde den Betriebsrentnern in der Aufhebungsvereinbarung ein bestimmter fester Betrag als betriebliche Versorgungsleistung zu Rentenbeginn zugesagt. Eine Anrechnung der gesetzlichen Rente oder der Ansprüche aus der Versorgungskasse auf einen Gesamtversorgungsbezug erfolgt in diesen Fällen nicht. Diese abweichenden Vereinbarungen können von mal zu mal unterschiedlich aussehen.
Ehemalige, welche ab 1985 ein Arbeitsverhältnis bei der Generali begonnen haben, haben Anspruch auf eine Betriebsrente nach einem Tarifvertrag, der so genannten VO 85. Dieser spricht den Betriebsrentnern eine Versorgungsleistung in einer zum Zeitpunkt des Rentenbeginns bestimmten Höhe zu. Bei den VO85-igern besteht kein Gesamtversorgungssystem mit anrechenbaren Teilbeträgen.
Ehemalige leitende Angestellte haben teilweise Sondervereinbarungen getroffen.
Die Regelungen zur Anpassung der betrieblichen Versorgungsleistungen gelten für alle o.g. Fälle. Zum 01. Juli gibt es regelmäßig jedes Jahr eine Anpassung entsprechend der Entwicklung der Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung.