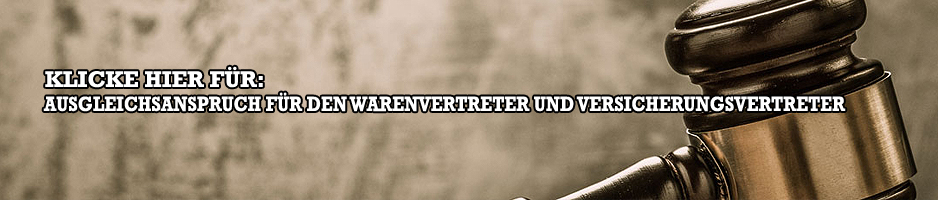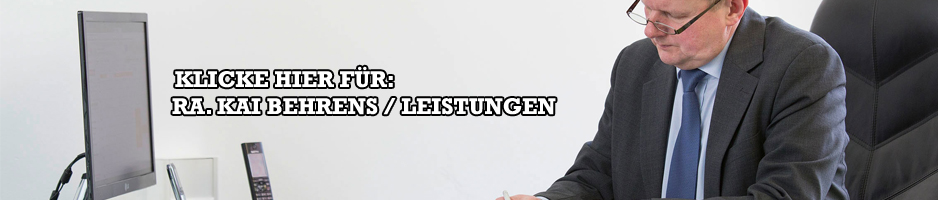21
„Alte“ Deutsche Regelung zum Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters europarechtswidrig
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses verliert ein Handelsvertreter den von ihm aufgebauten Kundenstamm an den Unternehmer, ohne dass er für neu abgeschlossene Geschäfte eine Provision erhält. Als Ausgleich für die im Aufbau eines Kundenstamms liegende Leistung des Handelsvertreters, die nach Vertragsbeendigung zugunsten des Unternehmers weiterwirkt, sieht § 89b HGB eine zusätzliche Vergütung vor. Um den Anspruch erfolgreich geltend machen zu können, müssen für den Unternehmer erhebliche Vorteile entstehen, die aus einer Geschäftsbeziehung zu Kunden resultieren, die der Handelsvertreter während seiner Vertragszeit neu geworben oder deren Geschäftsbeziehung er wesentlich erweitert hat.
Als Kehrseite der Vorteile für den Unternehmer entstehen dem Handelsvertreter Provisionsverluste. Der Umfang der Provisionsverluste richtet sich danach, was dem Handelsvertreter ohne Vertragsbeendigung zugestanden hätte. Der Ausgleichsanspruch konnte nach bisherigem Deutschen Recht nicht höher sein als die Vorteile des Unternehmers oder der Provisionsverlust für den Handelsvertreter.
Der EuGH hatte sich mit der Frage zu befassen, ob die deutschen Regelungen des HGB zum Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters bei Beendigung des Vertragsverhältnisses (§ 89b Abs. 1 Nr. 2 HGB) gegen europäisches Recht verstoßen (hier die Europäische Handelsvertreter-Richtlinie (Richtlinie 86/653/EWG zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter vom 18.12.1986).
Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters entgegen dem Wortlaut des § 89b Abs. 1 Nr. 2 HGB nicht von vornherein durch die Höhe der Provisionsverluste begrenzt werden darf, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile höher zu bewerten sind.
Nach Ansicht des EuGH führt die deutsche Regelung dazu, dass der Ausgleichsanspruch an die Höhe des Provisionsverlusts gekoppelt und somit im Zweifel nach unten angepasst wird. Dies widerspricht jedoch dem von der Richtlinie bezweckten Schutz des Handelsvertreters. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters kann daher nicht von vornherein durch die Höhe der Provisionsverluste begrenzt werden, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile höher zu bewerten sind.
Das bisherige deutsche Recht verstößt daher gegen die europäischen Vorgaben und muss angepasst werden. Außerdem wird sich die deutsche Rechtsprechung anpassen müssen. Die Möglichkeit, eine Ausgleichszahlung zu bekommen, dürfte in manchen Fällen wahrscheinlicher werden.
Die Entscheidung des EuGH im Volltext
1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 17 der Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der Rechts-vorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter (ABl. L 382, S. 17, im Folgenden: Richtlinie).
2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Semen, Pächter einer Tankstelle, und der Deutschen Tamoil GmbH (im Folgenden: Deutsche Tamoil) über die Höhe des Ausgleichs wegen Beendigung des Vertragsverhältnisses, den dieses Unternehmen Herrn Semen aufgrund der Kündigung seines Vertrags schuldet.
Rechtlicher Rahmen
Gemeinschaftsrecht
3 Art. 17 der Richtlinie bestimmt:
„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen dafür, dass der Handelsvertreter nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Anspruch auf Ausgleich nach Absatz 2 oder Schadensersatz nach Absatz 3 hat.
(2) a) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf einen Ausgleich, wenn und soweit
– er für den Unternehmer neue Kunden geworben oder die Geschäftsverbindungen mit vorhandenen Kunden wesentlich erweitert hat und der Unternehmer aus den Geschäften mit diesen Kunden noch erhebliche Vorteile zieht und
– die Zahlung eines solchen Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der dem Handelsvertreter aus Geschäften mit diesen Kunden entgehenden Provisionen, der Billigkeit entspricht. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass zu diesen Umständen auch die Anwendung oder Nichtanwendung einer Wettbewerbsabrede im Sinne des Artikels 20 gehört.
b) Der Ausgleich darf einen Betrag nicht überschreiten, der einem jährlichen Aus-gleich entspricht, der aus dem Jahresdurchschnittsbetrag der Vergütungen, die der Handelsvertreter während der letzten fünf Jahre erhalten hat, errechnet wird; ist der Vertrag vor weniger als fünf Jahren geschlossen worden, wird der Ausgleich nach dem Durchschnittsbetrag des entsprechenden Zeitraums ermittelt.
c) Die Gewährung dieses Ausgleichs schließt nicht das Recht des Handelsvertreters aus, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
…“
Nationales Recht
4 § 89b Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs in der zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden Fassung setzt Art. 17 Abs. 2 der Richtlinie in das nationale Recht um. Er lautet:
„Der Handelsvertreter kann von dem Unternehmer nach Beendigung des Vertrags-verhältnisses einen angemessenen Ausgleich verlangen, wenn und soweit
1. der Unternehmer aus der Geschäftsverbindung mit neuen Kunden, die der Handelsvertreter geworben hat, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile hat,
2. der Handelsvertreter infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses Ansprüche auf Provision verliert, die er bei Fortsetzung desselben aus bereits abgeschlossenen oder künftig zustande kommenden Geschäften mit den von ihm geworbenen Kunden hätte, und
3. die Zahlung eines Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände der Billigkeit entspricht.
Der Werbung eines neuen Kunden steht es gleich, wenn der Handelsvertreter die Geschäftsverbindung mit einem Kunden so wesentlich erweitert hat, dass dies wirtschaftlich der Werbung eines neuen Kunden entspricht.“
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
5 Herr Semen war vom 1. November 2001 bis zum 31. Dezember 2005 Pächter einer Tankstelle der Deutschen Tamoil in Berlin. Dort verkaufte er im Namen und für Rechnung dieses Unternehmens vor allem Kraftstoffe und Schmierstoffe, aber auch Telefonkarten unterschiedlicher Netzbetreiber, die es ihm zur Verfügung stellte.
6 Die Deutsche Tamoil gehört zur staatlichen libyschen Oilinvestgruppe, die in Deutschland ein Tankstellennetz von etwa 250 Stationen, sowohl unter der A-Marke „Tamoil“, ihrer Firma, als auch unter der – preisgünstigeren – B-Marke „HEM“, be-treibt.
7 Die Tankstelle von Herrn Semen war eine „HEM“-Station. Seine Provision bemaß sich bei Kraftstoffen nach der verkauften Menge („Literprovision“), bei Ölen nach dem Umsatz. Tankten Besitzer von Tankkarten, denen die Deutsche Tamoil Nachlässe gewährte, stand Herrn Semen nur eine geringere Provision zu.
8 Das Landgericht Hamburg wurde zur Entscheidung über den Herrn Semen zu zahlenden Ausgleich nach Beendigung seines Vertragsverhältnisses mit der Deutschen Tamoil angerufen.
9 Nach der deutschen Rechtsprechung haben die drei Tatbestandselemente des § 89b Abs. 1 HGB kumulativen Charakter und begrenzen einander. Der Ausgleich kann daher nicht höher als der niedrigste Betrag sein, der sich unter einer der drei Nummern ergibt.
10 Gestützt auf diese Rechtsprechung neigt das Landgericht dazu, Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen, dass diese Bestimmung, nach der Provisionsverluste des Handelsvertreters nur ein Element im Rahmen der Billigkeitsprüfung darstellen, auch zulässt, die dem Handelsvertreter entgehenden Provisionen als Obergrenze des Ausgleichs zu betrachten.
11 Da das Landgericht Hamburg im Hinblick auf diese Auslegung des Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie jedoch Zweifel hat, hat es das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist es mit Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie vereinbar, dass der Ausgleichs-anspruch des Handelsvertreters durch seine Provisionsverluste infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses begrenzt wird, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile höher zu bewerten sind?
2. Gehören hierzu bei einem Konzern, dem der Unternehmer angehört, auch die den Konzerngesellschaften zufließenden Vorteile?
Zu den Vorlagefragen
Zur ersten Frage
12 Mit seiner ersten Frage möchte das nationale Gericht wissen, ob Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass er es nicht erlaubt, dass der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters von vornherein durch seine Provisionsverluste infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses begrenzt wird, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile höher zu bewerten sind.
13 Hierzu ist einleitend festzustellen, dass Art. 17 der Richtlinie mit dem Blick auf die Ziele dieser Richtlinie und das damit eingeführte System auszulegen ist (vgl. Ur-teil vom 23. März 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, Slg. 2006, I-2879, Randnr. 17).
14 Weiter steht fest, dass die Richtlinie die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien eines Handelsvertretervertrags zum Ziel hat. So soll sie insbesondere die Interessen der Handelsvertreter gegenüber den Unternehmern schützen und legt zu diesem Zweck u. a. in den Art. 13 bis 20 Regeln über Abschluss und Beendigung des Handelsvertreter-vertrags fest (Urteil Honyvem Informazioni Commerciali, Randnrn. 18 und 19).
15 Was die Beendigung des Vertrags betrifft, wird mit Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie ein System geschaffen, das den Mitgliedstaaten ermöglicht, zwischen zwei Lösungen zu wählen. Sie haben nämlich die erforderlichen Maßnahmen dafür zu ergreifen, dass der Handelsvertreter nach Beendigung des Vertrags entweder Anspruch auf einen nach den Kriterien des Art. 17 Abs. 2 bestimmten Ausgleich oder auf nach den Kriterien des Art. 17 Abs. 3 bestimmten Schadensersatz hat.
16 Die Bundesrepublik Deutschland hat sich für die in Art. 17 Abs. 2 vorgesehene Lösung entschieden.
17 Nach ständiger Rechtsprechung ist das mit Art. 17 der Richtlinie geschaffene System, insbesondere was den Schutz des Handelsvertreters nach Vertragsbeendigung betrifft, zwingendes Recht (Urteil vom 9. November 2000, Ingmar, C-381/98, Slg. 2000, I-9305, Randnr. 21, und Honyvem Informazioni Commerciali, Randnr. 22).
18 Daher haben die Mitgliedstaaten, was den Ausgleich wegen Beendigung des Vertragsverhältnisses betrifft, nur innerhalb des durch die Art. 17 und 18 der Richtli-nie festgelegten Rahmens einen Gestaltungsspielraum bei der Wahl der Methoden zur Berechnung des Ausgleichs (Urteil Ingmar, Randnr. 21, und Urteil Honyvem In-formazioni Commerciali, Randnr. 35).
19 Das in Art. 17 der Richtlinie geregelte Verfahren läuft in drei Stufen ab. Auf der ersten geht es zunächst um die Quantifizierung der Vorteile des Unternehmers aus den Geschäften mit den vom Handelsvertreter geworbenen Kunden gemäß Art. 17 Abs. 2 Buchst. a erster Gedankenstrich der Richtlinie. Auf der zweiten Stufe wird dann nach Art. 17 Abs. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich geprüft, ob der Betrag, der sich auf der Grundlage der genannten Kriterien ergeben hat, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der dem Handelsvertreter entgangenen Provisionen, der Billigkeit entspricht. Schließlich wird auf der dritten Stufe der Ausgleichsbetrag an der in Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie festgelegten Höchstgrenze gemessen, die nur dann relevant ist, wenn der sich aus den vorstehenden beiden Berechnungsstufen ergebende Ausgleichsbetrag sie übersteigt.
20 Da die Provisionsverluste demnach nur einen von mehreren Gesichtspunkten darstellen, die im Rahmen der Billigkeitsprüfung relevant sind, ist es Sache des nationalen Gerichts, auf der zweiten Stufe seiner Bewertung zu prüfen, ob der dem Handelsvertreter gewährte Ausgleich letztlich billig erscheint und ob und gegebenenfalls inwieweit er unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls anzupassen ist.
21 In Anbetracht des in Randnr. 14 des vorliegenden Urteils dargelegten Ziels der Richtlinie ergibt sich aus diesem System, dass eine Auslegung von Art. 17 der Richt-linie, wie sie das nationale Gericht vertritt, nur zulässig ist, wenn sich ausschließen lässt, dass sie sich für den Handelsvertreter als nachteilig erweist.
22 In diesem Zusammenhang ist außerdem festzustellen, dass der Gerichtshof bereits auf den Bericht über die Anwendung von Art. 17 der Richtlinie (KOM[96] 364 endg.) Bezug genommen hat, den die Kommission am 23. Juli 1996 vorgelegt hat. Dieser Bericht enthält detaillierte Angaben über die tatsächliche Berechnung des Ausgleichs und soll eine einheitlichere Auslegung dieser Vorschrift erleichtern (vgl. Urteil Honyvem Informazioni Commerciali, Randnr. 35). So werden in diesem Bericht verschiedene Faktoren angeführt, die bei der Billigkeitsprüfung in der Praxis zu be-rücksichtigen sind und von denen einige für einen höheren Ausgleich sprechen.
23 Im Licht dieser Erwägungen ist daher festzustellen, dass der Gestaltungsspiel-raum, über den die Mitgliedstaaten verfügen, um den dem Handelsvertreter bei Vertragsbeendigung zustehenden Ausgleich aus Billigkeitsgründen gegebenenfalls an-zupassen, nicht dahin ausgelegt werden kann, dass dieser Ausgleich ausschließlich nach unten angepasst werden darf. Denn eine solche Auslegung von Art. 17 Abs. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie, die es ermöglichte, jede Erhöhung dieses Ausgleichs von vornherein auszuschließen, wäre eine Auslegung zum Nach-teil des Handelsvertreters, dessen Vertrag endet.
24 Daraus folgt, dass die in Randnr. 9 des vorliegenden Urteils dargelegte deutsche Rechtsprechung, die es von vornherein ausschließt, dass der Ausgleich im Rahmen der Anwendung des Billigkeitskriteriums bis zur Höhe der in Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie festgelegten Obergrenze erhöht wird, wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile höher sind als die geschätzten Provisionsverluste des Handelsvertreters, fehlgeht.
25 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass er nicht erlaubt, dass der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters von vornherein durch seine Provisionsverluste infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses begrenzt wird, auch wenn die dem Unter-nehmer verbleibenden Vorteile höher zu bewerten sind.
Zur zweiten Frage
26 Mit seiner zweiten Frage möchte das nationale Gericht wissen, ob Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass, falls der Unternehmer einem Konzern angehört, auch die den Konzerngesellschaften zufließenden Vorteile zu den Vorteilen des Unternehmers gehören und damit bei der Berechnung des Ausgleichs-anspruchs des Handelsvertreters zu berücksichtigen sind.
27 Für die Auslegung von Art. 17 Abs. 2 Buchst. a erster Gedankenstrich der Richt-linie ist zunächst auf den Wortlaut der Bestimmung abzustellen.
28 Insoweit ist festzustellen, dass sich diese Bestimmung ausschließlich auf die Vertragsbeziehungen „Kunden/Unternehmer“ und die Vorteile des „Unternehmers“ aus den Geschäften mit diesen Kunden bezieht. Die am Wortlaut von Art. 17 Abs. 2 Buchst. a erster Gedankenstrich der Richtlinie orientierte Auslegung führt daher zu der Schlussfolgerung, dass nach dieser Bestimmung Vorteile Dritter bei der Berechnung der „Vorteile des Unternehmers“ nicht berücksichtigt werden dürfen.
29 Diese Auslegung – ausschließlich die Beziehung zwischen dem Unternehmer und dem Handelsvertreter zu berücksichtigen – wird durch die systematische Auslegung dieser Bestimmung bestätigt.
30 Die in Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie vorgesehene Obergrenze des Ausgleichsbetrags wird nämlich anhand der vom Handelsvertreter erhaltenen Vergütungen berechnet. Wie die italienische Regierung vorgetragen hat, werden die Vergütungen, auch wenn der Unternehmer einem Konzern angehört, stets ausschließlich vom Unternehmer und nicht von den anderen Konzerngesellschaften bezahlt.
31 Schließlich ist festzustellen, dass die Richtlinie nach ihrem zweiten Erwägungs-grund die Sicherheit des Handelsverkehrs und damit die Rechtssicherheit auf dem Gebiet der Handelsvertretung fördern soll. Dieses Ziel schließt es grundsätzlich aus, Vorteile Dritter zu berücksichtigen, wenn das Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmer und dem Handelsvertreter dies nicht vorsieht. Es ist Sache des nationalen Gerichts, den Handelsvertretervertrag insoweit nach dem anwendbaren nationalen Recht zu beurteilen.
32 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass, falls der Unternehmer einem Konzern angehört, die den Konzerngesellschaften zufließenden Vorteile grundsätzlich nicht zu den Vorteilen des Unternehmers gehören und damit bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters nicht notwendig zu berücksichtigen sind.
Kosten
33 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:
1. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter ist dahin auszulegen, dass er nicht erlaubt, dass der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters von vornherein durch seine Provisions-verluste infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses begrenzt wird, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile höher zu bewerten sind.
2. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie ist dahin auszulegen, dass, falls der Unter-nehmer einem Konzern angehört, die den Konzerngesellschaften zufließenden Vor-teile grundsätzlich nicht zu den Vorteilen des Unternehmers gehören und damit bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters nicht notwendig zu berücksichtigen sind.