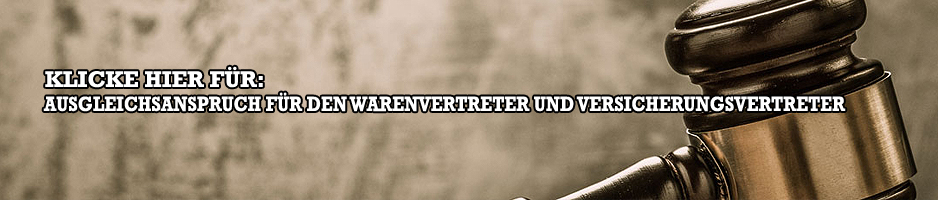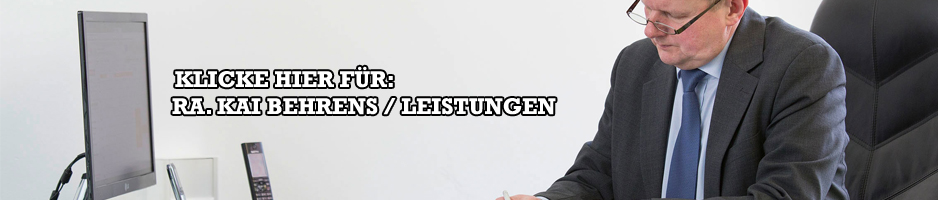16
Kündigungen durch Vertriebe wie DVAG und OVB
Im Handelsvertreter-Blog hatten wir darüber berichtet, dass es auch im Jahre 2025 Kündigungen von Ausschließlichkeitsvertretern von Vertrieben, wie zum Beispiel der DVAG oder der OVB, im Einzelfall gegeben hat.
Die Beweggründe waren unterschiedlich. Hier lassen sich die Beweggründe eines Vertriebes, sich von einem Versicherungsvertreter zu trennen, grob in verschiedene Kategorien einteilen.
Inaktivität
Es gab Kündigungen, die damit begründet wurden, dass der Berater inaktiv wäre. Konkret bedeutet dies, dass der Berater nicht genügend Versicherungsverträge neu vermittelt hat und auch keine neuen Kunden hinzugewonnen hat.
Vertriebe wie die DVAG und OVB sind am Wachstum orientiert. Vermittler sollen nach Möglichkeit Neugeschäft bringen. Ein Ausruhen auf den bereits eingebrachten Bestand, die Beschränkung der Tätigkeit auf das Verwalten des Kundenbestandes und die Durchführung von Schadensabwicklungen werden oftmals als ungenügend empfunden.
Nicht nur der Vermögensberatervertrag erwartet Leistung, sondern auch das Gesetz. Gem. § 86 Abs. 1 HGB hat der Handelsvertreter sich um die Vermittlung unter den Abschluss von Geschäften zu bemühen.
Dies entspricht zwar nicht unbedingt dem, wenn sich ein Handelsvertreter eigentlich ein freier und selbstständiger Gewerbetreibender ist. Er ist eben nicht – wie ein Arbeitnehmer – weisungsgebunden.
Dennoch ist es rechtlich zulässig, wenn ein Vertrieb eine ordentliche und fristgemäße Kündigung ausspricht. Eine solche Kündigung ist in § 89 HGB geregelt. Dabei müssen die gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfristen eingehalten werden.
Der Nennung eines Kündigungsgrundes bedarf es nicht. Deshalb werden Gründe für Kündigungen, die zum Beispiel von der DVAG ausgesprochen werden, in der Regel in dem Kündigungsschreiben nicht genannt. Das Gesetz verlangt dies auch nicht.
Vertragsverstoß
Im Einzelfall werden sogar fristlose Kündigungen wegen Inaktivität ausgesprochen. Dies hat zu Folge, dass der Vermögensberater von heute auf morgen bei diesem Vertrieb keine Verträge mehr einreichen kann. Es hat auch zur Folge, dass in der Regel nur noch die bis dahin verdienten Provisionen ausgezahlt werden.
Dies ist einem Vermögensberater passiert, der für die Allfinanz DVAG tätig war. Man warf ihm vor, er habe sich auf dem Bestand ausgeruht und sich nicht mehr um Neugeschäft gekümmert. Nach einigen Gesprächen und nach einer Abmahnung wurde ihm fristlos gekündigt. Das LG Frankfurt erklärte diese fristlose Kündigung für unwirksam.
Für den Fall einer solchen fristlosen Kündigung sind strenge formale Voraussetzungen einzuhalten. In der Regel ist der Berater zuvor abzumahnen. Nur dann, wenn ein weiterer Verstoß festgestellt werden kann, darf fristlos gekündigt werden. Der Grund, der bei der Abmahnung genannt wurde, darf nicht der Grund sein, auf dem die fristlose Kündigung beruht.
In der Regel enthält die fristlose Kündigung auch den Zusatz, dass hilfsweise die ordentliche Kündigung erklärt wird. Entsprechend endet dann ein solch gekündigter Vertrag spätestens mit Ablauf der regulären Kündigungsfrist.
Ein solcher, wie eben genannter Kündigungsgrund, stellt sich als Vertragsverstoß dar. So Jedenfalls könnte die vertriebliche Argumentation aussehen.
Gem. § 86 Abs. 1 HGB hat der Handelsvertreter sich um die Vermittlung unter den Abschluss von Geschäften zu bemühen. Dies ist in der Regel auch in dem jeweiligen Handelsvertretervertrag geregelt, auch im Vermögensberatervertrag.
Eine fristlose Kündigung beruht dann auf der Annahme, dass gegen eine solche Bemühungspflicht verstoßen wurde.
So war dies auch in dem oben genannten Fall, als die DVAG dem Vermögensberater die fristlose Kündigung aussprach. Nachdem die fristlose Kündigung vom Landgericht Frankfurt für unwirksam erklärt wurde, wurde der Vermögensberatervertrag durch die fristgemäße Kündigung beendet.
Strafbares Verhalten
Wenn sich ein Berater strafbar macht, kann auch dies eine fristlose Kündigung rechtfertigen.
Die DVAG hat beispielsweise etwa ein Jahr nach Verurteilung davon erfahren, dass ein Vermögensberater bereits zuvor zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das LG Frankfurt hatte eine darauf beruhende fristlose Kündigung – trotz des langen Zeitablaufes – für wirksam erklärt. Diese Entscheidung wurde vom OLG Frankfurt nicht überprüft. Dem Vermögensberater wurde die gewerbliche Zulassung gem. § 34 d Abs. 1 GewO übrigens nicht entzogen. Die IHK hatte auch – nach und trotz der Verurteilung – keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Vermittlers.
In dem Fall bedurfte es bei einer fristlosen Kündigung keiner Abmahnung. Gem. § 89a Abs. 1 HGB muss lediglich ein wichtiger Grund für die sofortige Beendigung des Vertrages vorliegen.
In der Regel wird verlangt, dass in einem solchen Fall – statt der Abmahnung – zumindest eine Anhörung erfolgt. Ob eine Anhörung erforderlich ist, ist aber auch eine Frage des Einzelfalls. Auch hier hatte das LG Frankfurt in einem Fall entschieden, dass eine fristlose Kündigung unabhängig von der Anhörung wirksam ist. Hier hatte eine Vermögensberaterin die Betreuung von zwei älteren Damen übernommen, die auch gleichzeitig Kundinnen der DVAG waren und sich durch Kontoabhebungen einen Teil der Ersparnisse der Kundinnen einverleibte.
Problematisch bei fristlosen Kündigungen im Zusammenhang mit einer Straftat ist, dass die Kündigungen grundsätzlich zeitnah nach Kenntnisnahme erfolgen muss. In der Regel erfolgt die Kenntnisnahme einer Straftat zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch keine Verurteilung gibt. Das Begehen einer Straftat ist also bei Ausspruch der Kündigung noch gar nicht rechtskräftig festgestellt. Wenn die Straftat bestritten wird, gibt es zu diesem Zeitpunkt lediglich den Verdacht einer Straftat. Die Voraussetzungen für eine solche Verdachtskündigung sind streng. Das OLG Frankfurt hat eine darauf beruhende Kündigung kürzlich sogar für unwirksam erklärt.