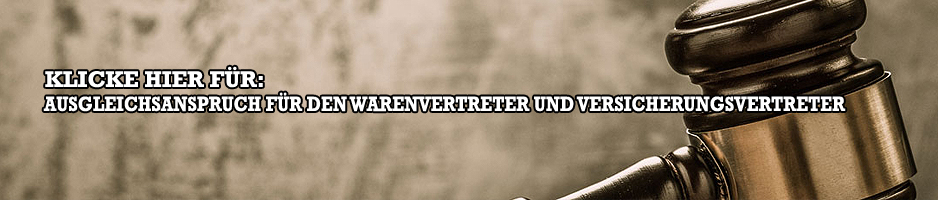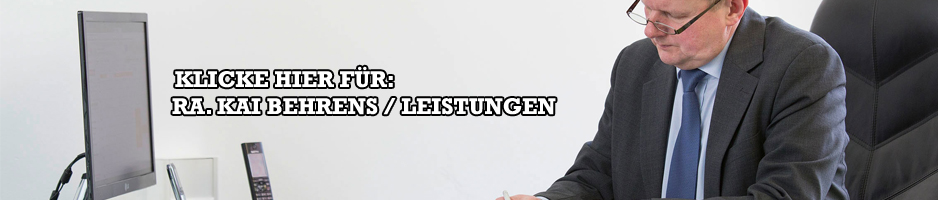Ist § 89 b HGB mit dem europäischen Recht vereinbar? Zumindest war § 89 b HGB bis 2009 damit unvereinbar.
Der EuGH hatte die Begrenzung des Ausgleichsanspruchs bei Handelsvertretern gemäß § 89 b HGB alter Fassung auf die Höhe der verlorenen Provisionsansprüche für europarechtswidrig hält ( EuGH 26.3.09 C-348/07) Das Gericht sieht darin einen Verstoß gegen die EU-Handelsvertreterrichtlinie (86/653/EWG), auf der §89 HGB basiert und die einem Handelsvertreter einen Ausgleich gewährt, wenn der Unternehmer das Vertragsverhältnis beendet.
Bei der Umsetzung der EU-Handelsvertreterrichtlinie haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, für den Handelsvertreter entweder nach Art. 17 Abs. 2 einen Ausgleichsanspruch oder nach Art. 17 Abs. 3 einen Schadenersatzanspruch zu schaffen. Deutschland hat sich für die erste Möglichkeit entschieden. Nach Art. 17 Abs. 2a der EU-Handelsvertreterrichtlinie hat der Handelsvertreter einen Ausgleichsanspruch, wenn und soweit
– er für den Unternehmer neue Kunden geworben oder die Geschäftsverbindungen mit vorhandenen Kunden wesentlich erweitert hat und der Unternehmer aus den Geschäften mit diesen Kunden noch erhebliche Vorteile zieht und
– die Zahlung eines solchen Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der dem Handelsvertreter aus Geschäften mit diesen Kunden entgehenden Provisionen, der Billigkeit entspricht.
Nach Art. 17 Abs. 2b der EU-Handelsvertreterrichtlinie ist der Ausgleich ebenfalls gedeckelt. Er darf nicht höher sein als der Jahresdurchschnittsbetrag der Vergütungen, die der Handelsvertreter während der letzten fünf Jahre erhalten hat; ist der Vertrag vor weniger als fünf Jahren geschlossen worden, wird der Ausgleich nach dem Durchschnittsbetrag der entsprechenden Zeitraums ermittelt.
Nach Art. 17 Abs. 2c der EU-Handelsvertreterrichtlinie schließt die Gewährung des Ausgleichs nicht das Recht des Handelsvertreters aus, Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
Der EuGH hatte klargestellt, dass die von der deutschen Rechtsprechung vertretene Begrenzung des Ausgleichsanspruchs der Höhe nach auf die Provisionsverluste nach § 89 b Abs. 1 S. 1 Nr.2 HGB alter Fassung gegen Art. 17 Abs. 2a) der Handelsvertreterrichtlinie verstößt und damit europarechtswidrig ist (Tz. 9, 24 der Entscheidung).
Der EuGH weist ausdrücklich darauf hin, dass die Richtlinie „insbesondere die Interessen der Handelsvertreter gegenüber den Unternehmen schützen soll“ und dass dieser Schutz nach Art. 17 zwingendes Recht ist.
Der EuGH stellt weiter klar, dass Vorteile Dritter bei der Berechnung der „Vorteile des Unternehmers“ grundsätzlich nicht berücksichtigt werden dürfen – es sei denn, dass dies ist im Vertragsverhältnis zwischen Unternehmer und Handelsvertreter vorgesehen ist (Tz. 31 der Entscheidung). Dies wird damit begründet, dass die Richtlinie ihrem Sinn und Zweck nach die Sicherheit des Handelsverkehrs und damit die Rechtssicherheit auf dem Gebiet der Handelsvertretung fördern soll.
EU-Richtlinien sind so in nationales Recht umzusetzen, dass sie eine optimale Wirkung (sog. „effet utile“) entfalten, damit der vereinheitlichende Sinn und Zweck des Gemeinschaftsrechts nicht gefährdet wird. Diesem Prinzip dient auch die richtlinienkonforme Auslegung, die neben die nationalen Auslegungsregeln tritt. Nationale Auslegungsspielräume sind nach dem Wortlaut und Zweck der Richtlinie auszufüllen (Weber-Grellet, Europäisches Steuerrecht, § 25, Rn. 9).
Grundsätzlich haben EU-Richtlinien keine unmittelbare Wirkung, sondern müssen von den Mitgliedstaaten innerhalb einer bestimmten Frist durch eine nationale Regelung umgesetzt werden. Man kann sich aber dann auf eine EU-Richtlinie berufen, wenn diese nicht innerhalb der angemessenen Frist umgesetzt worden ist und die entsprechende Richtlinienregelung inhaltlich unbedingt und hinreichend genau ist, um in Einzelfall angewendet zu werden.