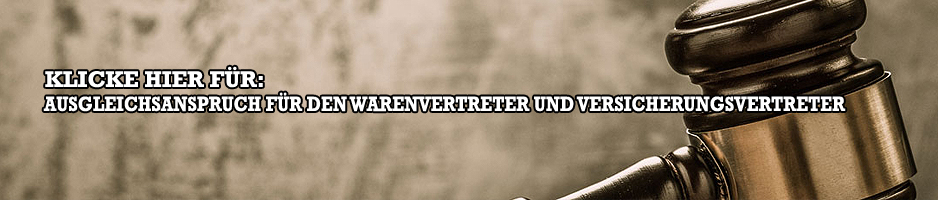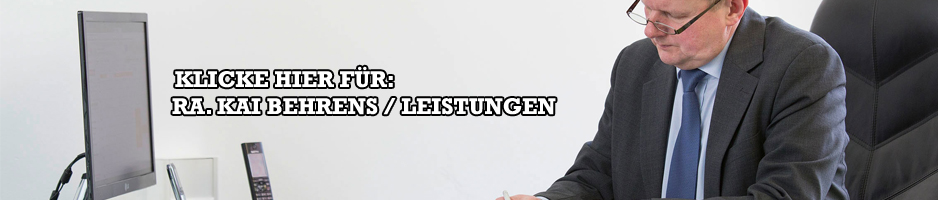15
Der perfekte Tag in Münster: Einen Tag mit einer Dame vom Cayenne-Escort.
Gegen den Namen Cayenne klagte jetzt Porsche AG (wegen seines Porsche Cayenne Diesel) … und gewann vor dem Landgericht Hamburg. Der Name Cayenne sei durch Porsche geschützt. Der Escort Service aus Münster dürfe sich nicht mehr so nennen. Man könnte ja das eine mit dem anderen verwechseln.
Pikantes nebenbei: Der Münsteraner Porschehändler soll sich eine exklusive Geschäftsidee überlegt haben. Wenn man einen Porsche Cayenne kauft, so soll er sich gedacht haben, soll man dann auch gleich eine Nacht mit einer Dame vom Escort Service aus Münster Verbringen dürfen. Früher gab es mal ein Handy oder einen PC „obendrauf“, heute mal etwas anderes.
Mit diesem Ansinnen soll der Porschehändler an den Escort Service herangetreten sein. So zumindest wurde es in dem Verfahren vor dem Hamburger Landgericht eidesstaatlich versichert. Da die Porsche AG jedoch mit dem Händler nichts weiter zu tun hat, als eben bloß diese eine handelsvertretungsvertragliche Beziehung, hatte dies für die Hamburger Richter keinen Einfluss.
Der Escort-Service darf sich nach dem erstinstanzlichen Urteil in Zukunft nicht mehr Cayenne nennen.
Porsche AG in Spiegel Online: „Wir distanzieren uns vollständig von diesen Dingen“.
Urteil des Landgerichts Hamburg Aktenzeichen 327 O 562/13.